Allgemeines
Das Wort "Relais" kommt aus dem Französischen und heisst "Schaltstelle".
Relais und Schütze sind fernbetätigte Schalter. Einsatzgebiete dieses elektronischen Bauteiles liegen vorwiegend in der Kommunikationstechnik, der Automatisierungs- u. Regeltechnik sowie in der Elektronik.
Aufbau und Funktion eines Relais
Bei einem Relais handelt es sich um einen elektromagnetischen Schalter.
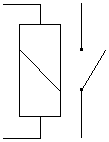 Schaltzeichen
eines Relais
Schaltzeichen
eines Relais
Ein Strom erregt den Elektromagneten, der dann durch die Bewegung des Ankers einen örtlichen Stromkreis öffnet oder schliesst. Das Relais dient zur Steuerung eines beliebig starken Stroms im gesteuerten Kreis durch einen schwächeren Erregerstrom.
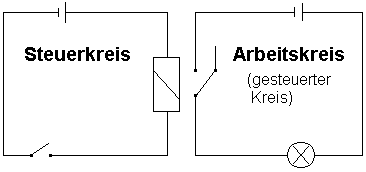 Steuer- u.
Arbeitskreis
Steuer- u.
Arbeitskreis
Steuerkreis und Arbeitskreis sind galvanisch
getrennt. Es bestehen zwei verschiedene Antriebsmöglichkeiten:
In der Arbeitsstromschaltung zieht der Magnet den Anker an und
schliesst den Arbeitskreis, solange der Steuerkreis geschlossen ist.
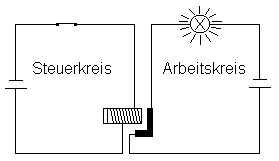 Schema einer
Arbeitsstromschaltung
Schema einer
Arbeitsstromschaltung
In der Ruhestromschaltung wird der Anker dauernd angezogen. Dadurch ist der Arbeitskreis geöffnet. Wird nun der Steuerkreis unterbrochen, so schliesst der zurückfedernde Anker den Arbeitskreis. Diese Schaltung wird häufig bei Sicherungsanlagen verwendet. So kann zum Beispiel bei einer Unterbrechung des Steuerkreies automatisch Alarm ausgelöst werden.
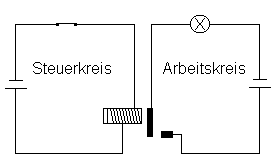 Schema einer
Ruhestromschaltung
Schema einer
Ruhestromschaltung
Bauarten
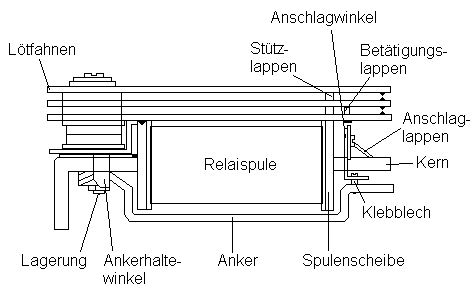
| Flachrelais | Sein Anker betätigt Federsätze. |
| elektron. Relais | Bei diesem Relais handelt es sich um eine elektrische Schaltung, die bei geringer Änderung der ihr zugeführten (Steuer-) Spannung den Ausgangsstrom stark ändert. Diese Relaisart arbeitet praktisch trägheitslos und ohne mechanische Abnutzung (Verschleiss). |
| Neutrales Relais | Es ist unabhängig von der Stromrichtung. |
| Polarisiertes Relais | Seine Ankerbewegung ist von der Stromrichtung des Erregerstromes abhängig. Haupteinsatzgebiet ist die Fernmeldetechnik. |
| Resonanzrelais | Dieses Relais schaltet nur bei einer bestimmten Frequenz des Erregerstroms. Haupteinsatzgebiet ist die Funksteuerung, wo mehrere Vorgänge über eine Verbindung zu steuern sind. |
| Thermorelais | Es besteht aus einem Bimetallstreifen, der durch eine aufgebrachte Heizwicklung erwärmt wird. Durch die Erwärmung verbiegt er sich und betätigt einen Kontakt. |
| Wechselstromrelais | Das Flackern des Ankers infolge der Wechselstromerregung wird durch besondere Massnahmen verhindert. |
Das Mikrorelais
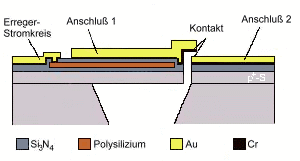 Mikrorelais-Schema (Querschnitt)
Mikrorelais-Schema (Querschnitt)
Die Kombination von Metall-Oberflächenmikromechanik
und anisotropen Ätzen von Silizium ermöglicht die Herstellung von Mikrorelais
mit geringer Baugrösse auf einem einzigen Siliziumsubstrat.
Auf der Oberseite der Balken befindet sich ein Heizwiderstand aus Polysilizium
und darauf eine mit der Kontaktfeder verbundene Metallschicht (Nickel,
Gold). Beide sind untereinander und zum Balken hin dielektrisch durch
eine Siliziumnitrid-Schicht isoliert. Aufgrund der eingestellten mechanischen
Spannungen in dem Schichtaufbau sind die Balken im Ruhezustand nach oben
ausgelenkt. Werden sie über den Erregerstromkreis beheizt, verwölben sie
sich durch den Bimetall-Effekt nach unten. Dabei berührt die Kontaktfeder
am Balkenende eine Kontaktfläche am Rand der anisotrop geätzten Grube,
so dass der Laststromkreis geschlossen wird.
Kenngössen von Relais
Die Anzugsspannung UAN
gibt an, wann das Relais den Kontakt schliesst.
Der dazugehörige Strom wird als Anzugsstrom IAN
bezeichnet. Die Spannung, bei der der Kontakt wieder geöffnet wird, wird
als Abfallspannung UAB bezeichnet. Daraus
ergibt sich IAB für den Abfallstrom.
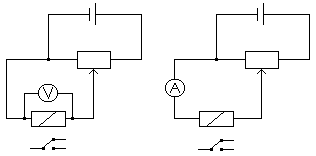 Schaltpläne zur Ermittlung der Kenngrössen
Schaltpläne zur Ermittlung der Kenngrössen
Eine weitere Kenngrösse ist der Fehlstrom. Es handelt sich dabei um die Stromstärke, bei der das Relais den Anker noch nicht angezogen hat. Der Haltestrom bezeichnet die Stromstärke, bei der der Anker noch vom Relais gehalten wird. Demnach gibt es auch die Fehlspannung und die Haltespannung. Als Durchflutung wird das Produkt aus Windungszahl und Stromstärke bezeichnet. Die Durchflutung ist abhängig von dem Luftspalt (Anker-Spule) und der Belastung des Ankers.
Spezielle Relaisschaltungen
Das selbsthaltende Relais
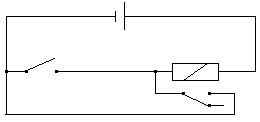 Schaltplan
zum selbsthaltenden Relais
Schaltplan
zum selbsthaltenden Relais
Durch einen Druck auf den Taster zieht das Relais an und der Taster wird überbrückt. Trotz eines geöffneten Tasters bleibt der Relaiskontakt dann geschlossen.
Eine mögliche Anwendung könnte darin liegen, an den Relaiskontakt eine Sirene anzuschliessen und den Taster durch eine Lichtschranke zu ersetzen. Bewegt sich jetzt beispielsweise eine Person durch die Lichtschranke, schliesst diese kurz den Stromkreis (Funktion des Tasters), das Relais schliesst den Kontakt und die Sirene gibt Alarm. Würde keine solche Schaltung verwendet, wäre der Alarmton nur so lang, wie die Person in der Lichtschranke steht.
Der Wagnersche Hammer
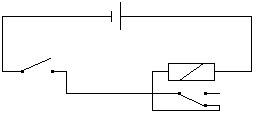 Schaltplan
zum Wagnerschen Hammer
Schaltplan
zum Wagnerschen Hammer
Ein Druck auf den Taster bewirkt, dass das Relais den Kontakt schliesst und damit den Stromkreis von Taster und Relais öffnet. Dadurch wird das Relais vom Stromkreis getrennt und kann den Anker nicht mehr halten. Dieser fällt ab und kehrt somit in den Urzustand zurück. Damit wird der Stromkreis wieder geschlossen und der Vorgang startet erneut. Dieses Prinzip wird zum Beispiel bei einer Klingel angewendet.
Ein Schütz ist ein elektromagnetisch betätigter Schalter, mit dem Motoren und andere elektrische Geräte ans Netz gelegt werden. Die Schütze besitzen für Drehstrom drei Hauptkontakte und zusätzlich Hilfskontakte. Sie werden durch den Anker eines Elektromagnetem betätigt, dessen Erregerspule (Steuerspule) in einem besonderen Steuerkreis liegt. Die Hilfskontakte öffnen oder schliessen weitere Stromkreise. In Sonderfällen schalten sie von einem Kreis auf einen anderen um. Sie heissen je nach der ausgeführten Schaltfunktion Öffner, Schliesser oder Wechsler. Je nach dem Medium, in dem die Kontakte liegen, unterscheidet man in Luft- und Ölschütze.
Für die elektrische Ausrüstung von Industrimaschinen wird nach DIN EN 60204 Teil /VDE 0113 Teil1 (06/93) vorgeschrieben, dass die der Sicherheit dienenden Stromkreise nach Abschnitt 9.4 ausgeführt sein müssen. In diesen Sicherheitskreisen muss durch das Zusammenwirken von Hilfsschützen eine Redundanz gewährleistet sein, damit im Fall eines Fehlers in einem der Hilfsschütze der Sicherheitskreis wirksam bleibt. In jedem Ein-Aus-Zyklus der Maschine müssen die Hilfsschütze mindestens einmal automatisch auf richtiges Öffnen und Schliessen der Kontakte überprüft werden.
Motorschutzrelais
Hilfsschalter im Motorschutzrelais
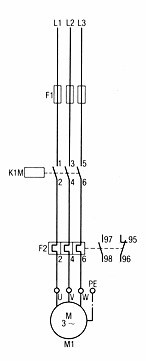
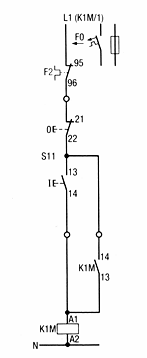
Im Gegensatz zu Auslösern (zum Beispiel in Leistungsschaltern oder Motorschutzschaltern), die mechanisch direkt ein Schaltschloss entklinken, betätigen Motorschutzrelais bei Überstrom einen Hilfsschalter. Erst ein daran angeschlossenes Schaltgerät schaltet den gefährdeten Motor ab. Als Hilfsschalter werden üblicherweise galvanisch getrennte Öffner und Schliesser verwendet. Der Öffner unterbricht den Spulenstromkreis des zugehörigen Schützes. Mit dem Schliesser kann ein Ausgelöstsignal weitergegeben werden
Abbildungen:
links: Hauptstromverdrahtung eines Motorschutzrelais
rechts: Hilfsstromverdrahtung eines Motorschutzrelais
Phasenausfallempfindlichkeit
Wird bei einem Fehler eine Zuleitung zum Motor unterbrochen, läuft dieser mit zwei Phasen weiter. Der Strom in den Wicklungen steigt dabei auf eine unzulässige Höhe. Das Motorschutzrelais soll diesen Zustand erkennen und beschleunigt auslösen. Das wird durch die differenzierte Auswertung der Bimetallstellungen bewirkt. Bei dreipoliger Belastung biegen sich die Bimetalle gleichmässig aus und verschieben die Auslöse- und Differentialbrücke in die gleiche Richtung. Der Auslösehebel betätigt bei Erreichen des Grenzwertes den Hilfsschalter. Wird bei einem Phasenausfall ein Bimetall nicht ausgebogen, verschieben sich Auslöse- und Differentialbrücke gegeneinander. Dieser Differenzweg wird durch ein Hebelsystem in zusätzlichen Auslöseweg umgewandelt und führt zu einer beschleunigten Auslösung.
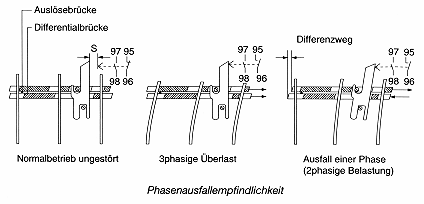
© November 1998 by Claudia Dolgner und René Schubert; Klasse 11D Kurs 11K6