Asynchrongeneratoren haben ihren Namen durch die Eigenschaft, daß der Rotor nie mit der Frequenz des Stators umläuft, dieser Effekt wird Schlupf s genannt. Der Schlupf berechnet sich aus der synchronen Drehzahl des Stators (Netzdrehzahl) und der Drehzahl des Rotors: s = (ns - n) / ns. Der Schlupf kann zwischen 1 (bei Stillstand) und 0 (bei idealem Leerlauf) betragen. Im normalen Betrieb ist s < 0,10. Die synchrone Drehzahl ergibt sich aus der Netzfrequenz f und der Polpaarzahl p: ns = f / p Bei einer Netzfrequenz von 50 Hz und einer Polpaarzahl von 1 (zwei Pole, ein Paar) ergibt sich eine synchrone Drehzahl von 3000 Umdrehungen pro Minute. Diese Drehzahlen erfordern den Einsatz von Getrieben. Der Rotor einer Asynchronmaschine ist meist als Kurzschluß- oder Käfigläufer ausgeführt, er benötigt keine Stromzuführung, da im Rotor eine Spannung durch das Drehfeld des Stators induziert wird. Voraussetzung für die Induktion ist aber ein Blindstrom im Stator, diese Blindleistung wird im Netzbetrieb zum Teil aus dem Netz bezogen, im Inselbetrieb ist für eine Blindleistungskompensation zu sorgen. Asynchrongeneratoren werden meist im Netzparallelbetrieb verwendet, dieses "Dänische" Konzept ist weit verbreitet. Wenn genügend Wind vorhanden ist, wird die Anlage an das Netz geschaltet, wodurch die Asynchronmaschine den Rotor zunächst als Motor beschleunigt. Wird die synchrone Drehzahl dann erreicht, geht die Maschine in den Generatorbetrieb über und die Anlage speist Energie in das Netz ein.
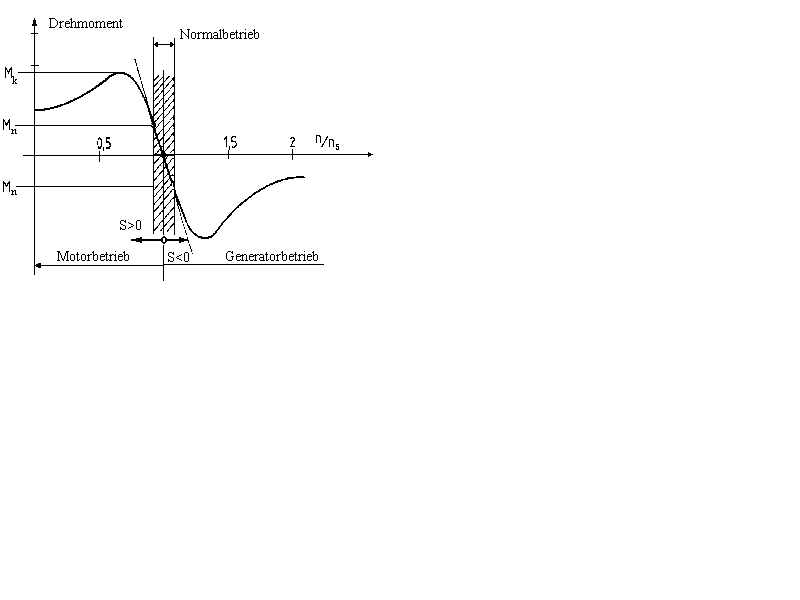
Abb. 1: Drehmoment- Drehzahl- Kennlinie
Um Aussagen über das Drehmomentverhalten
einer Asynchronmaschine zu machen, müssen die Daten des Kippunktes einer
Maschine, Kippmoment Mk und Kippschlupf sk
gegeben sein. Mit der Kloßschen Formel: M/Mk
= 2 / (s / sk + sk / s)
läßt sich das Drehmoment für jeden Schlupf bestimmen.
Beim Dänischen Konzept ist die Rotorbetriebsdrehzahl fast konstant. Wenn
auch andere Windgeschwindigkeiten besser genutzt werden sollen, gibt es
die Möglichkeit, einen zweiten Generator anzuschließen, auf den bei Bedarf
umgeschaltet werden kann. Eine andere Variante ist die Nutzung von polumschaltbaren
Generatoren, wodurch ebenfalls die Nenndrehzahl verändert werden
kann.
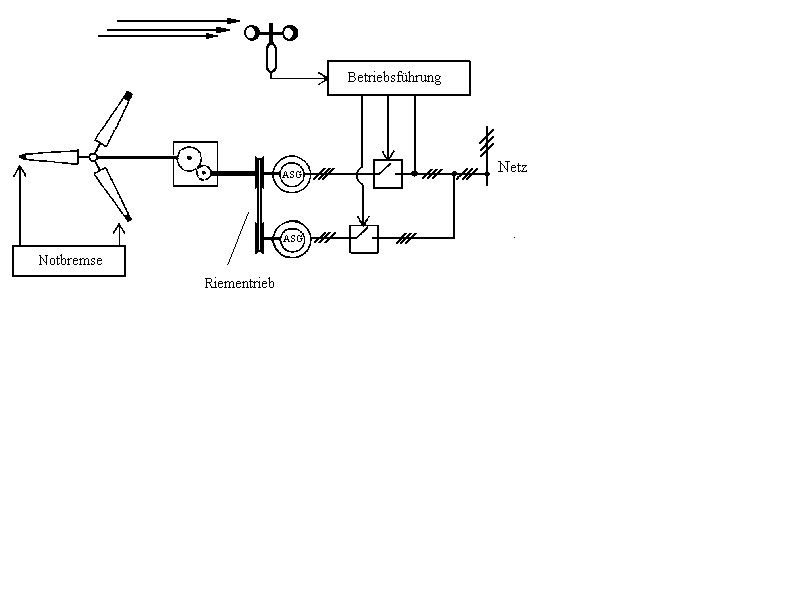
Abb. 2: Blockschaltbild des Dänischen Konzeptes
Durch den Schlupf ist eine "weiche" Energieübertragung gegeben, das heißt bei plötzlichen Windstößen kann die Rotordrehzahl durch die Veränderung des Schlupfes variieren wobei der Kippschlupf natürlich nicht überschritten werden darf. Durch dieses Verhalten wird das Material geschont.
Quelle: TU Berlin Institut für Energietechnik - Erneuerbare Energien