ENERGIEVERSORGUNG
Damit die
Energie an ihr Ziel kommt
Bei uns kommt der Strom aus der Steckdose", lautet ein flapsiger Spruch
zum Thema Energieversorgung. Damit der Strom aber immer aus der Dose kommt,
ist erheblicher Aufwand nötig.
In Shanghai gibt es ihn und in New York, am Nordkap und in der Sahara: Strom. Überall, selbst unter extremen Bedingungen werden heute Menschen und Einrichtungen mit Energie versorgt. Dabei sind Stromnetze viel mehr als eine Ansammlung von Leitungen. Wie komplex sie sind, wird meist erst bewusst, wenn von einem großen Blackout die Rede ist, oder man selbst von einem längerdauernden Stromausfall betroffen ist.

Die Leitstelle eines Lastverteilers ist eine der wichtigsten Einrichtungen im Netz
Verbesserte
Drehstromübertragung
Als Netze immer stärker ausgelastet wurden, Widerstände gegen neue Leitungen
stiegen und die Deregulierung vermehrt Durchleitungen erforderte, wurde FACTS
(Flexible AC Transmission System) entwickelt. In deregulierten Systemen muss
der Betreiber die Kunden mit dem wirtschaftlichsten Erzeuger verbinden. "Damit
ändern sich die Lastflüsse im Netz", erläutert Povh. "Mit FACTS-Geräten lassen
sie sich im vorhandenen Netz realisieren. Ohne FACTS nimmt der Strom nicht immer
den vorgesehenen Weg, der natürliche Lastfluss stimmt nicht mit dem vertraglichen
überein. Wenn die französische EDF Strom nach Italien exportiert, fließt derzeit
ein großer Teil über Belgien, die Schweiz und Deutschland. In deregulierten
Systemen sind ungeplante Umwege nicht akzeptabel. Zudem bietet die Technik nun
Möglichkeiten, Lastflüsse vorauszuberechnen und zu lenken."
Ergänzend zu Parallel-Reglern wie SVC oder STATCOM (Static Synchronous Compensator)
entstanden Lastflussregler in Reihenschaltung: thyristorgeregelte Serienkompensatoren,
Thyristor Controller Phase Shifter und Universal-Lastflussregler. "Die Entwicklung
geht schnell," sagt Povh, "da sie vorhandene Techniken kombiniert und keine
neuen Technologien verlangt. FACTS lässt sich in etwa einem Jahr installieren.
So kann man Probleme rasch lösen und die Zeit bis zur Langzeitlösung überbrücken."
Eine
Aufgabe für den Gleichstrom
Für große Entfernung ist Gleichstrom günstig, da es bei ihm keine Blindleistung
gibt. Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) wurde in den 30er Jahren entwickelt
und mit Quecksilberdampf-Ventilen nach dem Krieg realisiert. Der große Durchbruch
kam jedoch mit Halbleiter-Ventilen in den 60er Jahren. Bekanntestes Projekt
dieser Pionierzeit war die 1400-km-Verbindung von Cabora Bassa in Mozambique
nach Südafrika. "In Europa speisen wir verstärkt Strom ferner Wasserkraftwerke
ein", sagt Povh, "z.B. aus Norwegen." Zweite Aufgabe von HGÜ ist das Zusammenschalten
nicht-synchroner Netze. Das betrifft das Koppeln von 50- und 60-Hz-Netzen in
Südamerika und Japan, aber auch Netze unterschiedlicher Frequenzkonstanz: Die
UCPTE (Union pour la Coordination de la Production et du Transport de l'Electricité)
in Europa arbeitet mit engem Frequenzband, dagegen erlauben die Ukraine, Russland
Bulgarien und Rumänien größere Schwankungen.Auch
NORDEL (Nordiskt Samarbete på Elkraftområde) in Skandinavien arbeitet nicht
synchron zur UCPTE.

Die HGÜ-Anlage Nan Qiao verbindet Shanghai mit dem 1000 km entfernten Wasserkraftwerk Gezhouba
Sicherer Netzbetrieb
Stromausfälle können zu hohen Folgeschäden führen. Qualitativ hochwertige Versorgung
bedeutet primär wenig Unterbrechungen. In Deutschland liegen sie pro Verbraucher
bei durchschnittlich zehn Minuten im Jahr, da die vielen Kabelnetze wenig störanfällig
sind. Die Planung sorgt mit entsprechenden Reserven dafür, dass niemand durch
die Störung und die Reparaturarbeiten länger ohne Strom bleibt. Spektakuläre
Ausfälle traten dagegen in letzter Zeit im Westen der USA auf. Das Netz ist
langgezogen, überbrückt große Strecken. Nach Meinung Povhs ist es das komplexeste
Netz der Welt. Er erklärt die Blackouts so: " Auch Leitungstrassen wollen gepflegt
sein, sonst kann es Kurzschlüsse über Bäume geben – das ist hier passiert.
Dann haben Schutzgeräte fehlerhaft gearbeitet, haben auch Parallelleitungen
abgeschaltet." Damit begann ein Dominoeffekt: Ein Kraftwerk fiel aus, weil es
nicht mehr einspeisen konnte, somit fehlte Energie im Netz. Dann trennten sich
wie vorgesehen Netzteile ab. Da aber viel Strom von Norden kommt, gab es in
Südkalifornien zu wenig Leistung – der Blackout war da.
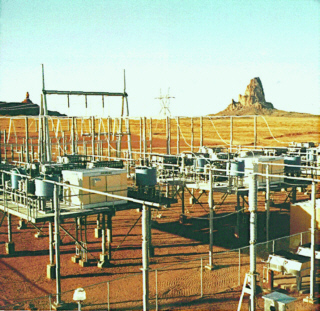
Der kontinuierlich geregelte Serienkompensator in Kayenta (Arizona) ersparte den Bau einer neuen Freileitung
Wenn Städte
im Lichtermeer erstrahlen, Fabriken arbeiten, elektrische Bahnen fahren, dann
sind immer auch alle Elemente der Netze beteiligt. Prof. Dr.-Ing. Dusan Povh,
Leiter des Fachbereichs Netzplanung im Siemens-Bereich Energieversorgung, zeigt
die Netzstruktur auf: "Am Anfang stehen natürlich die Kraftwerke, die große,
komplexe Einheiten sein können. Dann wird die Energie in Transformatoren hochgespannt
und ins Übertragungsnetz eingespeist. Es dient dem Leistungsaustausch und dem
Transport zu den Lastzentren, die z.B. in Deutschland meist 50 bis 80 km von
den Kraftwerken entfernt sind. Weitere Elemente sind Schaltgeräte, die das Netz
konfigurieren und schützen.
Eine Eigenheit des Wechselstroms der Wechselfelder erzeugt, ist die Blindleistung;
sie ist zum Feldaufbau nötig bzw. wird beim Abbau frei. Mit Kompensatoren kann
sie nach Bedarf erzeugt oder verbraucht werden. Wird große Leistung weit übertragen,
muss man Blindleistung allerdings sehr schnell regeln, damit die Spannung in
vorgegebenen Grenzen bleibt; man kombiniert Induktivitäten, Kapazitäten, Thyristoren
und Regelung zu Statischen Kompensatoren (SVC – Static Var Compensator).
"SVC senken Kosten," erklärt Povh, "weil sich damit das Netz höher auslasten
und trotzdem stabil halten lässt. "Im Störfall," sagt Povh, "soll das Netz geregelt
zerfallen, soll weniger wichtige Last abgeworfen werden, um den Betrieb der
wichtigen zu gewährleisten. Störungen dürfen das Netz nicht lahmlegen, doch
das ist bei komplexen Netzen nicht einfach." In Europa ist ein großer Blackout
wenig wahrscheinlich, weil die Teilnetze kaum voneinander abhängen. Mit Deregulierung
und vermehrten Durchleitungen kann sich das ändern. Interessant, so Povh, sei
die Entwicklung in England und Wales. Hier entstanden neue Kraftwerke im Norden,
wo Erdgas zur Verfügung steht. Plötzlich transportierte das Netz Strom über
200 bis 400 km. Kompensationsanlagen mussten installiert werden, obwohl sich
der Verbrauch kaum veränderte.
Wichtig ist auch die Qualität der Spannung: sie soll konstant und flickerfrei
sein. Gleichzeitig gibt es immer mehr elektronische Geräte, die Oberschwingungen
verursachen; das Netz wird immer stärker mit den unerwünschten Effekten belastet.
Daher setzt man Filter ein. Dusan Povh: "Konventionelle Filter bestehen aus
Induktivität und Kapazität. Wir bieten jedoch eine dynamische Lösung, Elektronik,
die Oberwellen negativ einspeist und damit vernichtet. Dieses Gebiet wird sich
entwickeln: Störungen und Ansprüche nehmen zu." Spannungsschwankungen verursachen
z.B. in der Papierindustrie Qualitätseinbrüche. Große Ansprüche stellen Lackierereien
der Autoindustrie, weil die Lackschichten so dünn sind, dass kleinste Störungen
den Lackfilm unterbrechen. Höchst sensible Verbraucher sind Chip-Fabriken: Eine
Störung kann hier zu Folgekosten in Millionenhöhe führen.
Netzplanung im High-Tech-Labor
Netzplanung muss neben den Kosten auch Umweltschutz und Städtebau, Ausbau- und
Integrationsfähigkeit berücksichtigen. Die Planung untersucht, wie sich die
Last entwickeln wird und passt das Netz an, sorgt dafür, dass die erwartete
Last angeschlossen werden kann. Povh vergleicht das mit Statikberechnungen in
der Architektur: "Die Planung bestimmt, ob und wo zusätzliche Netzelemente nötig
sind." Dazu werden High-Tech-Werkzeuge eingesetzt; so berechnen DV-Programme
optimale Konfigurationen bereits bei Entwicklung und Projektierung.
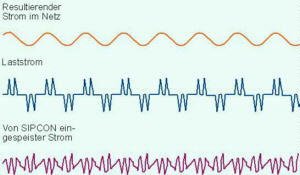
Filtern von Oberschwingungen im Laststrom mit SIPCON®P; der resultierende Netzstrom ist fast oberschwingungsfrei
Ergebnisse
der Simulation sind heute sehr verlässlich. Regelungen lassen sich am Rechner
simulieren; Netze können so genau nachgebildet werden, dass man dynamische Vorgänge
untersuchen kann. "Wir haben ein Programm, mit dem sich Tausende von Knoten
und Zehntausende von Leitungen nachbilden lassen", sagt Povh. "Damit lässt sich
das UCPTE-Netz zusammen mit Nachbarnetzen simulieren. So wird untersucht, was
beim Zusammenschluss passieren kann. Für Simulationen in Echtzeit setzen wir
Analog- und Hybridsysteme ein. Damit testen wir das Verhalten von komplexen
Systemen wie SVC oder FACTS im Netz. Auf der Anlage sind dann nur noch wenige
Fälle zu untersuchen." Für den Lastanstieg gibt es Programme, die Temperatur,
Wochentag und weitere Faktoren berücksichtigen – z.B. ob ein Fußballspiel
im Fernsehen übertragen wird. Die Berechnung geht laut Povh nicht mit konventionellen
Methoden, sondern benötigt Neuronale Netze. Aus den gesammelten Daten lernt
das Programm täglich dazu, die Prognosen werden immer besser."
Eine Welt – ein Netz?
Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn sind seit kurzem synchron mit Westeuropa
verbunden. Sie haben in Frequenzregelung investiert, sind dann parallel gefahren.
"Sie mussten Kraftwerke mit neuer Regelung ausrüsten und Reserven aufbauen",
so Povh. Dies ist UCPTE-Philosphie: Jeder hat eigene Reserven, der Verbund dient
kurzzeitigem Leistungsausgleich. Marokko und später weitere Länder Nordafrikas
verbinden sich mit dem UCPTE-Netz. "Synchrone Netze sind ein Politikum", meint
Povh. "Für Osteuropa ist es Symbol: Wir gehören dazu! Ähnliches gilt für Nordafrika."
Kommt das weltumspannende Netz, das Global Grid? Dazu Dusan Povh: "Versuche
und Erfahrung zeigen, dass man Strom über Tausende Kilometer übertragen kann."
Man diskutiert, Strom vom Kongo nach Ägypten und weiter nach Europa zu übertragen.
Das Haupthindernis heißt Zuverlässigkeit, weil die Verbindung über viele Länder
liefe. Die politischen Verhältnisse müssen dafür erst reif sein. "Teile des
Global Grid werden sicher bald gebaut. Man will Strom von Kraftwerken hinter
dem Ural nach Europa liefern. Doch es muss sich rechnen", sagt Povh.
Interdisziplinäre Arbeit
Planung und Realisation von Netzen haben sich drastisch verändert. Zu konventionellen
Techniken kamen Leistungselektronik und Kommunikation. "Es wird nicht nur klassische
Übertragungstechnik angewandt," so Prof. Povh, "es kommt zur Vermischung mit
anderen. Unsere Techniker sind keine reinen Energietechniker, sie müssen auch
andere Gebiete kennen. Schließlich laufen technische Einrichtungen, die ganze
Planung über Rechner; dazu kommt noch der Datenaustausch. Netze bestehen nicht
mehr aus monolithischer Technik, wie vielleicht noch vor 30 Jahren."
Volkmar Dimpfl
Quelle: © Siemens AG 2000, D-80312 München, letzte Änderung: 25.07.2000